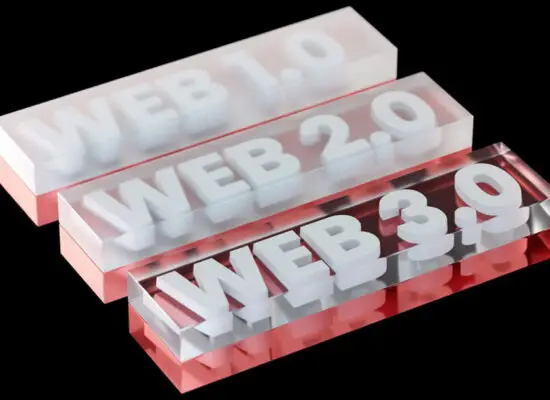Ein Taxi bestellt man sich heute nicht mehr per Telefon, sondern über eine App. Einkäufe werden nicht mehr im Laden erledigt, denn es geht ja viel einfach über einen Klick auf der Couch und Musik wird nicht mehr auf CDs gebrannt, sondern geht über Plattformen wie SoundCloud oder TikTok viral.

Wer genau hinschaut, merkt schnell, dass sich die Wirtschaft rund um Plattformen, die nichts besitzen, aber alles koordinieren, neu organisiert. Die Rede ist von der Plattformökonomie. Ein Begriff, der technokratisch klingen mag, aber einen der tiefgreifendsten Strukturwandel unserer Zeit beschreibt.
Digitale Plattformen als neue Vermittler zwischen Angebot und Nachfrage
Im Zentrum dieser neuen Wirtschaftsform steht keine Produktionsstätte, keine Lagerhalle, kein Ladengeschäft. Stattdessen übernehmen Plattformen wie Airbnb, Amazon oder Uber eine Vermittlerrolle. Sie bringen Angebot und Nachfrage zusammen, ohne selbst Produkte herzustellen oder Dienstleistungen zu erbringen. Das klingt erst einmal simpel, hat aber weitreichende Folgen. Denn diese Plattformen schaffen Strukturen, in denen Interaktionen stattfinden, steuern Preise durch Algorithmen, regeln Sichtbarkeit über Ratings und organisieren Märkte, in denen sie selbst nicht der Anbieter sind.
Entscheidend sind dabei die sogenannten Netzwerkeffekte. Je mehr Menschen eine Plattform nutzen, desto attraktiver wird sie für andere. Wer einmal einen Account bei eBay oder Etsy hat, bleibt oft auch dort. Schlicht, weil die Auswahl groß ist und alle anderen ebenfalls dort sind. Gleichzeitig lassen sich digitale Plattformen schnell skalieren. Ein zusätzlicher Nutzer erzeugt kaum zusätzliche Kosten, bringt aber unter Umständen neue Daten, neue Inhalte oder neue Umsätze mit sich. Kein Wunder also, dass diese Geschäftsmodelle geradezu explosionsartig wachsen können.
Dabei ist Plattform nicht gleich Plattform. Neben den klassischen Transaktionsplattformen, die Käufer und Verkäufer zusammenbringen, gibt es auch Innovationsplattformen wie den App Store von Apple, auf denen Dritte eigene Angebote entwickeln können. Oder soziale Plattformen wie Instagram, die Kommunikation und Inhalte in den Vordergrund stellen, aber mit Werbung und Datenanalyse ihr Geld verdienen.
Nicht jede übergeordnete Website ist eine Plattform im Sinne der Plattformökonomie
Angesichts des Plattform-Hypes wird der Begriff derzeit ziemlich inflationär genutzt. Nicht alles, was im Netz stattfindet, ist automatisch Teil der Plattformökonomie. Eine wichtige Unterscheidung liegt in der Art der Interaktion. Während Plattformen aktive Beziehungen zwischen verschiedenen Nutzergruppen ermöglichen, sind viele Webseiten lediglich Verzeichnisse, Vergleichsportale oder redaktionelle Listings.
Ein Beispiel ist das Portal von Casino Groups, denn diese Seite listet Online-Casinos auf, betreibt jedoch keine Vermittlung im engeren Sinne. Es gibt keine eigene Zahlungsabwicklung, kein Nutzerprofil mit Bewertungsfunktion und keine direkte Interaktion zwischen Spieler und Anbieter über die Plattform. Es handelt sich also nicht um eine Plattform im klassischen Sinne, sondern um eine kuratierte Übersicht, ähnlich einem Branchenbuch im digitalen Gewand.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen einem themenspezifischen Online-Verzeichnis und einer echten Plattform im Sinne der Plattformökonomie lässt sich auch daran erkennen, dass zum Beispiel die gesamte Kaufabwicklung und Logistik (wie bei Amazon) auf der Plattform selbst stattfindet. Ein Online-Verzeichnis setzt lediglich einen externen Link, welcher zwar seine Berechtigung im Online Marketing hat, aber daher sein Wirken an dieser Stelle an die verlinkte Website abgibt.
Die Plattform selbst gibt so wenig wie möglich ab, ganz im Gegenteil. Plattformen versuchen stets alle Bedürfnisse der User und deren Onlineaktivitäten auf ihrer eigenen Plattform abdecken zu können. Diese Vorgehensweise hat einen essentiellen Grund. Dies ist die Basis dafür Märkte und Wettbewerbsstrukturen nachhaltig zu prägen.
Wie Plattformen Märkte und Wettbewerbsstrukturen prägen
Wer heute eine neue Idee hat, landet früher oder später bei einer Plattform, sei es, um Produkte zu verkaufen, Inhalte zu veröffentlichen oder Dienstleistungen anzubieten. Das Problem dabei ist nur, dass man, einmal in ein Plattform-Ökosystem eingestiegen, nur schwer wieder herauskommt. Die großen Namen dominieren ihre Märkte mit einer Mischung aus Datenmacht, Kapital und Kundenbindung. Amazon ist im Onlinehandel fast alternativlos, Google im Werbemarkt omnipräsent und Apple diktiert die Regeln im App-Geschäft.
Diese Marktkonzentration hat handfeste Auswirkungen. Kleine Anbieter stehen unter Preisdruck, müssen sich an Spielregeln halten, die sie nicht mitgestalten können, und verlieren im schlimmsten Fall die Sichtbarkeit, sobald der Algorithmus sie anders bewertet. Gleichzeitig entstehen neue Geschäftsmodelle, die ohne Plattformen nicht existieren würden.
Plattformen bauen eigene Ökosysteme auf, kaufen Wettbewerber auf, bündeln Angebote und werden zu digitalen Alleskönnern. Wer Produkte auf Amazon verkauft, nutzt oft auch die Lagerlogistik, das Advertising-Tool und die Bezahlschnittstelle des Konzerns. Die Plattform wird zur Infrastruktur, vergleichbar mit einem digitalen Stromnetz, nur dass es privat betrieben wird.
Auswirkungen der Plattformökonomie auf Arbeit und Beschäftigung
Auch die Arbeitswelt bleibt von der Plattformökonomie nicht verschont. Statt Festanstellung heißt es nun Gig-Economy (Arbeitsmarktmodell, bei dem kurzfristige Aufträge an Selbstständige über Plattformen vergeben werden). Plattformen wie Uber, Fiverr oder Lieferando versprechen Flexibilität, Eigenverantwortung und unkomplizierten Zugang zum Arbeitsmarkt. Die Realität ist jedoch oft weniger glamourös. Viele Jobs sind schlecht bezahlt, kaum abgesichert und abhängig von algorithmisch generierten Aufträgen. Wer für eine Plattform arbeitet, ist in der Regel formal selbstständig. Das bedeutet keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, keine Rentenversicherung und kein Kündigungsschutz. Es entsteht eine neue Form der Abhängigkeit, bei der der Auftraggeber nicht greifbar ist.
Einfluss der Plattformökonomie auf Konsum, Kommunikation und Informationsverhalten
Wer denkt, Plattformen betreffen nur Wirtschaft und Arbeit, verkennt ihren Einfluss auf den Alltag. Ob Netflix, Spotify oder Google Maps – Plattformen prägen, was konsumiert, gehört, gekauft oder auch geglaubt wird. Sie bestimmen was sichtbar ist und was überhaupt erst entsteht. Denn wenn Algorithmen festlegen, welche Inhalte viral gehen, wird irgendwann nur noch produziert, was auch Klicks verspricht.
Besonders auffällig ist das im Bereich der sozialen Medien. Plattformen wie Facebook oder TikTok liefern einen konstanten Strom an Informationen, Meinungen und Emotionen: kuratiert, gefiltert und oft polarisiert. Die Auswirkungen auf politische Meinungsbildung, Diskussionskultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt sind längst spürbar. Der kreative, investigative und informative Ansatz von Content Creation hat sich dadurch zunehmend zu einem politischen und wirtschaftlichen Werkzeug entwickelt. Dazu kommt, dass viele Plattformen heute ganze Alltagsroutinen ersetzen. Statt einen Handwerker im Bekanntenkreis zu fragen, wird auf MyHammer gesucht. Statt Restauranttipps vom Kellner gibt es Google-Bewertungen. Der Alltag wird datengetrieben, bequem, aber auch kontrollierbarer, manipulierbarer und durchsichtiger.
Was Politik und Gesellschaft der Plattformökonomie entgegensetzen
Die wirtschaftliche Wucht der Plattformen ist nicht mehr zu übersehen, die politischen Reaktionen sind aber noch immer viel zu oft zaghaft. Zwar gibt es mit dem Digital Markets Act der EU erste Versuche, Plattformgiganten in die Schranken zu weisen, doch die Durchsetzung ist zäh und voller Ausnahmen.
Ein zentrales Problem dabei ist, dass solche Plattformen global agieren, Regulierung aber meist auf nationaler – oder Wirtschaftsraum-Ebene geschieht. Während Facebook weltweit Nutzer gewinnt, ist der Datenschutz in Europa „nur“ ein lokales Thema. Gleichzeitig fehlt es an Alternativen. Öffentlich rechtliche Plattformen oder genossenschaftlich organisierte Modelle sind selten und schwer skalierbar.
Plattformökonomie: Spiegel und Motor gesellschaftlicher Transformation
Plattformen sind zu Taktgebern der Wirtschaft geworden, zu Architekten des digitalen Alltags und zu politischen Akteuren mit eigenem Machtanspruch. Die Plattformökonomie bringt Chancen, keine Frage, aber eben auch neue Abhängigkeiten, Ungleichgewichte und Herausforderungen.
Wem gehört die digitale Infrastruktur? Wer kontrolliert die Daten? Und welche Regeln gelten auf den virtuellen Marktplätzen der Zukunft? All das sind Fragen, die nicht allein von Konzernen beantwortet werden dürfen. Denn so unsichtbar Plattformen oft agieren, ihre Wirkung ist real, spürbar und nachhaltig. Wer die Zukunft verstehen will, muss die Plattformen verstehen und das am besten, bevor sie alles verstanden haben.